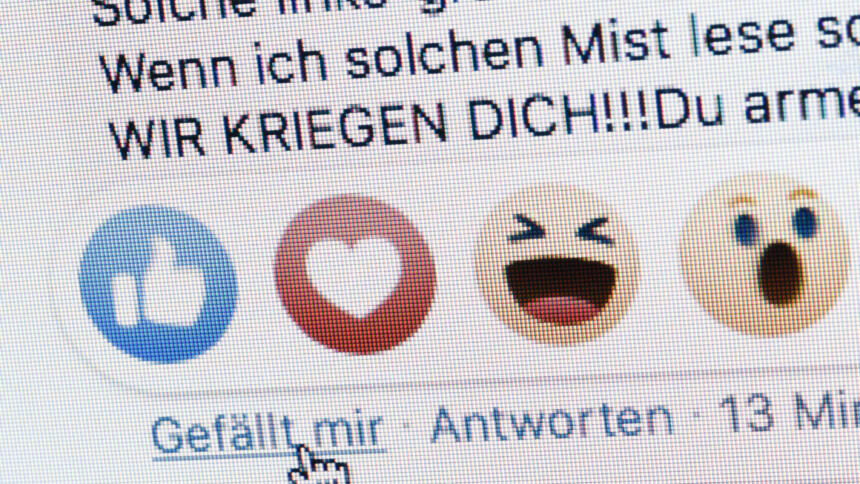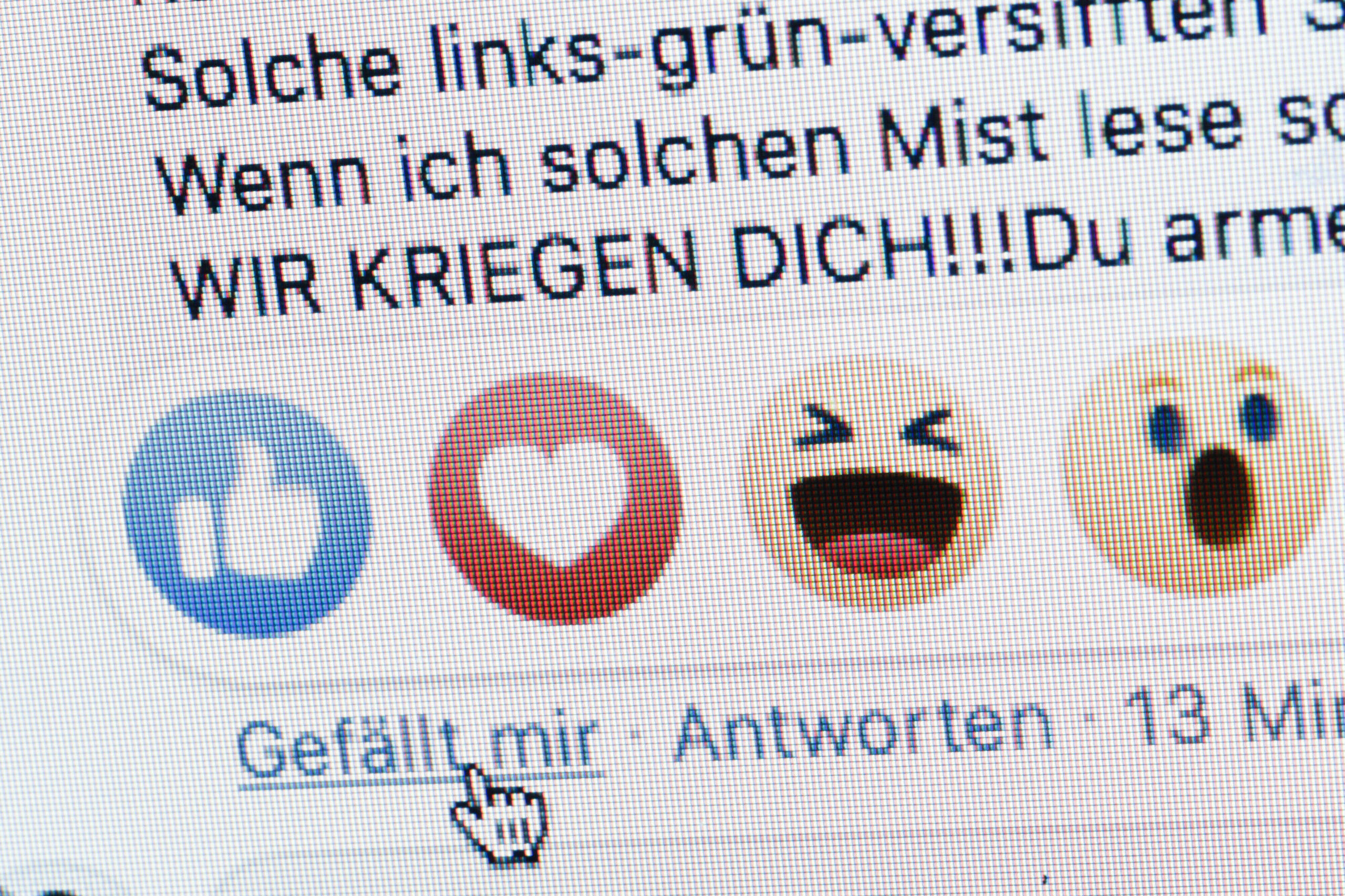Die elektronische Patientenakte sei sicher, versichert die Bundesregierung. Doch ihre Antworten auf eine Kleine Anfrage lassen die Zweifel an diesem Versprechen wachsen. Versicherte sollen der ePA offenbar blind vertrauen – selbst wenn ihre Gesundheitsdaten bei US-Behörden landen könnten.

Die meisten von uns besitzen einen Haustürschlüssel. Und die meisten von uns wissen, wer sonst noch Zugang zu unserer Wohnung hat. Bei den Gesundheitsdaten, die in der elektronischen Patientenakte hinterlegt sind, ist das offenkundig nicht so klar. Das zeigen die Antworten der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion „Die Linke“.
Die Abgeordneten haben die Regierung unter anderem gefragt, welche Vorkehrungen verhindern sollen, dass etwa die US-Regierung an sensible Gesundheitsdaten von deutschen Versicherten gelangt. Die Antworten der Bundesregierung sind mitunter missverständlich, in Teilen unvollständig und fehlerhaft.
Nachfragen bei dem zuständigen Gesundheitsministerium, verschiedenen Krankenkassen und der Gematik haben nur wenig Licht ins Dunkel gebracht. Offenkundig sollen die Versicherten weitgehend bedingungslos darauf vertrauen, dass ihre sensiblen Daten in der ePA sicher sind.
Krankenkassen verweigern Auskunft
Anlass der Kleinen Anfrage war eine Aussage des Chefjustiziars von Microsoft Frankreich im Juni dieses Jahres. Er hatte in einer öffentlichen Anhörung vor dem französischen Senat nicht ausschließen können, dass der Tech-Konzern Microsoft auf Anordnung US-amerikanischer Behörden auch Daten europäischer Bürger:innen weitergeben müsse.
Hintergrund ist unter anderem der US-amerikanische Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, kurz CLOUD Act, aus dem Jahr 2018. Das Gesetz verpflichtet US-Tech-Anbieter unter bestimmten Voraussetzungen zur Offenlegung von Daten gegenüber US-Behörden – auch wenn sich diese Daten außerhalb der Vereinigten Staaten befinden.
Die Abgeordneten der Linksfraktion fragten die Bundesregierung, ob sie ein ähnliches Szenario bei den in der ePA hinterlegten Gesundheitsdaten ausschließen könne. Die Regierung erwidert, dass sie nichts über die Verträge zwischen den Betreibern der ePA und den Krankenkassen wisse. Sie kenne daher die Regelungen nicht, mit denen die Daten der Versicherten geschützt würden. Betreiber von ePA-Infrastrukturen sind spezialisierte IT-Dienstleister wie IBM Deutschland und das österreichische Unternehmen RISE.
Wir haben uns bei den drei größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland erkundigt, welche vertraglichen Vereinbarungen sie mit ihren externen Anbietern getroffen haben. Weder die Techniker Krankenkasse noch die Barmer oder die DAK wollten unsere Frage beantworten. Sie verweisen auf die Gematik, die als Nationale Agentur für Digitale Medizin für die Spezifikationen zur technischen Ausgestaltung der ePA zuständig sei. Der Barmer-Sprecher bittet zudem um Verständnis, dass er sich „aus Wettbewerbsgründen“ nicht weiter zu den Vertragsbedingungen äußern könne.
Es ist also unklar, ob es entsprechende Regelungen zum Schutz der Versichertendaten gibt, von denen die Bundesregierung spricht.
Der Schlüssel liegt bei den Betreibern
Desweiteren verweist die Bundesregierung auf „umfangreiche technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen“, die zum Schutz der Gesundheitsdaten umgesetzt worden seien. So dürften die in der ePA hinterlegten Daten nur verschlüsselt bei den Betreibern gespeichert werden. Ohne „den Schlüssel der Versicherten“ könnten Unbefugte die Daten nicht lesen, betont die Regierung.
Diese Antwort ist mindestens missverständlich formuliert. Tatsächlich verfügt die ePA derzeit über keine patientenindividuelle Verschlüsselung, bei der jede:r Versicherte die eigene Patientenakte mit einem persönlichen Schlüssel absichert. Ältere Versionen der ePA sahen noch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der in der Patientenakte hinterlegten Daten vor; die aktuelle „ePA für alle“ bietet dieses Mehr an Sicherheit allerdings nicht mehr.
Außerdem sind die Schlüssel nicht, wie noch bei früheren ePA-Versionen, auf der elektronischen Gesundheitskarte der Versicherten hinterlegt, sondern sie liegen auf den Servern des ePA-Betreibers. Sogenannte Hardware Security Modules in einer „vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung“ würden gewährleisten, dass die Betreiber keinen direkten Zugriff auf diese Schlüssel haben, schreibt das Gesundheitsministerium auf Nachfrage von netzpolitik.org.
„Diese speziell abgesicherten Komponenten sind dafür ausgelegt, kryptografische Schlüssel sicher zu verwalten und sensible Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen“, sagt eine Gematik-Sprecherin auf Anfrage. Ein direkter Zugriff auf die Schlüssel, auch durch die Betreiber der ePA, sei technisch ausgeschlossen. Die Schlüssel werden etwa dann zur Entschlüsselung der Gesundheitsdaten verwendet, wenn die Versicherten ihre elektronische Gesundheitskarte beim Besuch einer Praxis oder einer Apotheke in ein Lesegerät schieben.
Offene Eingangstüren
Zwei Aspekte lassen das Gesundheitsministerium und die Gematik bei ihren Ausführungen jedoch unter den Tisch fallen.
Zum einen ist den Sicherheitsfachleuten des Chaos Computer Clubs Bianca Kastl und Martin Tschirsich in den vergangenen Monaten wiederholt gelungen, die Zugriffskontrolle der ePA zu überwinden.
Bei den von ihnen beschriebenen Angriffsszenarien hilft Verschlüsselung nicht mehr viel. „Es ist vollkommen egal, dass das irgendwie verschlüsselt gespeichert wird, wenn an der Eingangstür ein paar Wissensfaktoren reichen, um jede ePA in Zugriff zu bekommen“, sagt Bianca Kastl, die auch Kolumnistin bei netzpolitik.org ist.
Die von ihr und Tschirsich aufgezeigten Sicherheitslücken bestehen teilweise noch immer fort. Eine „endgültige technische Lösung“ will das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erst im kommenden Jahr implementieren.
Trügerische Sicherheit
Zum anderen behauptet die Bundesregierung, dass die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen einen „technischen Betreiberausschluss“ gewährleisten, „sodass selbst ein fremdbestimmter Betreiber keinen Zugriff auf die Daten der ePA erlangen würde“.
Hauptbetreiber von elektronischen Patientenakten ist die IBM Deutschland GmbH. Unter anderem die Techniker Krankenkasse, die Barmer Ersatzkasse und die AOK haben das Unternehmen damit beauftragt, die ePA und die dazugehörigen Aktensysteme gemäß der von der Gematik gemachten Spezifikationen umzusetzen. Mehr als zwei Drittel aller digitalen Patientenakten laufen auf IBM-Systemen, aus Sicherheitsgründen seien die Daten „über zahlreiche, geographisch voneinander getrennte Rechenzentrums-Standorte in der IBM Cloud in Deutschland verteilt“, so das Unternehmen.
Dieses Sicherheitsversprechen ist jedoch trügerisch. Denn die IBM Deutschland GmbH ist eine Tochter der US-amerikanischen IBM Corp. – und damit potenziell ein „fremdbestimmter Betreiber“. Gemäß CLOUD Act können US-Behörden IBM dazu zwingen, die Daten von deutschen Versicherten an sie auszuleiten.
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt?
Welche Risiken der CLOUD Act birgt, hat etwa das baden-württembergische Innenministerium erkannt. Im Juli räumte es in einer Stellungnahme ein, dass US-Behörden theoretisch auf Daten zugreifen könnten, die in der Verwaltungscloud Delos gespeichert sind. Delos Cloud ist ein Tochterunternehmen von SAP und fußt auf Microsoft Azure und Microsoft 365. Dem Ministerium zufolge könnten US-Behörden den Tech-Konzern anweisen, „einen Datenabfluss in seine Software zu integrieren, ohne dass der Kunde darüber in Kenntnis gesetzt wird.“
Dennoch plant die Bundesregierung nach eigenem Bekunden nicht, die technologische Abhängigkeit von nicht-europäischen ePA-Betreibern zu prüfen – obwohl sie die digitale Patientenakte explizit als eine kritische Infrastruktur einstuft.
Anne Mieke-Bremer, Sprecherin für Digitale Infrastruktur der Fraktion Die Linke im Bundestag, kritisiert diese Weigerung der Regierung. „Statt klare Prüfpflichten festzuschreiben, versteckt sie sich hinter lückenhaften Vorgaben“, so Mieke-Bremer. „Und sie gibt sich damit zufrieden, dass die Verträge zwischen Betreibern und Kassen eine Blackbox bleiben.“
Die ePA wirke „zunehmend wie ein mangelhaftes und fahrlässiges Prestigeprojekt“, das voller Lücken und Risiken ist, sagt Stella Merendino, Sprecherin der Linken für Digitalisierung im Gesundheitswesen. „Was mit unseren sensibelsten Gesundheitsdaten passiert, bleibt dabei im Dunkeln.“
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.