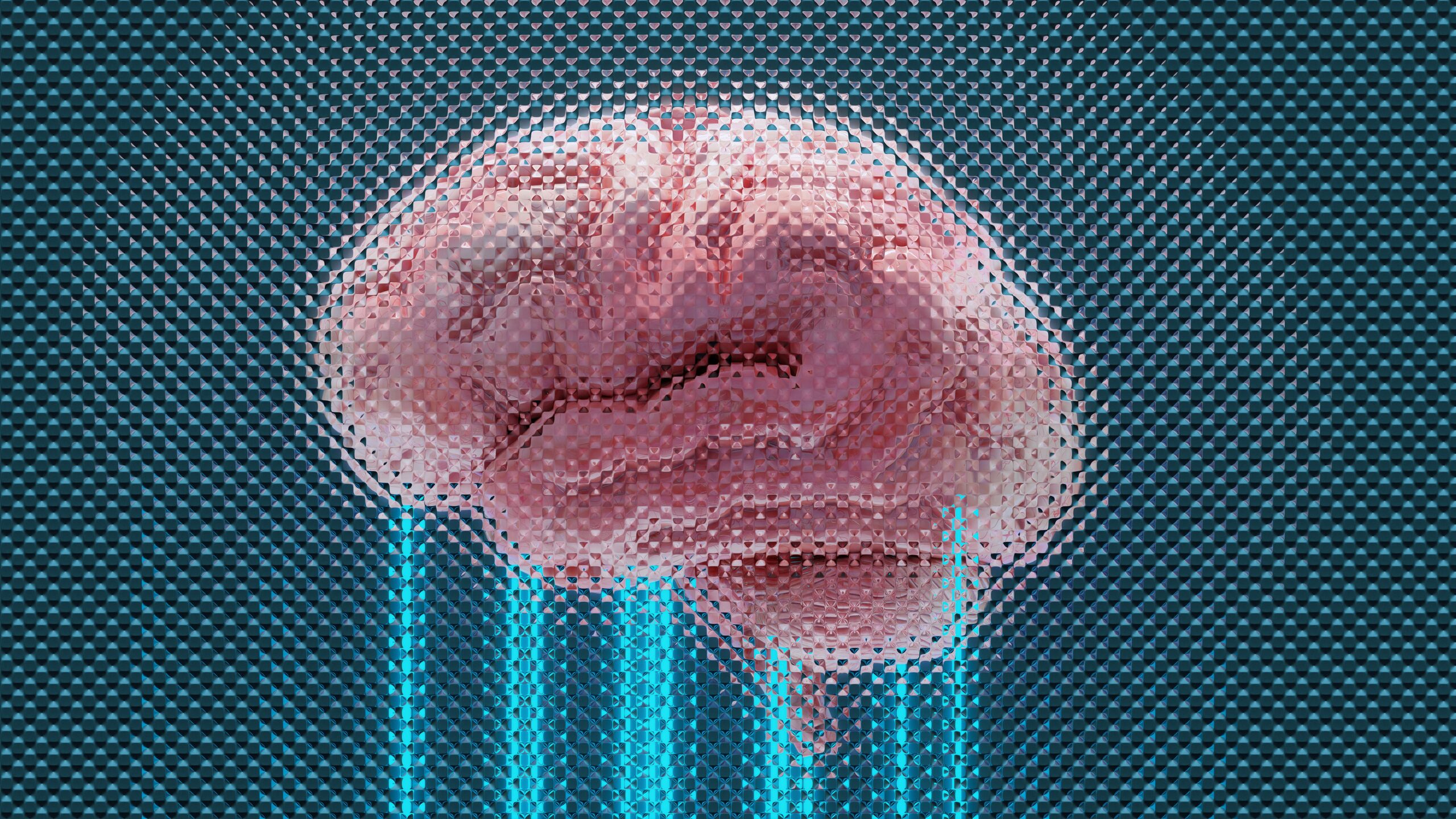Die Innen- und Gesundheitsminister:innen haben auf ihren letzten Konferenzen über den Umgang mit psychisch erkrankten Personen beraten. Doch Ideen wie ein „integriertes Risikomanagement“ oder Datenaustausch zwischen Gesundheitsbehörden und Polizeien treiben Stigmatisierung voran und behindern angemessene Hilfe.
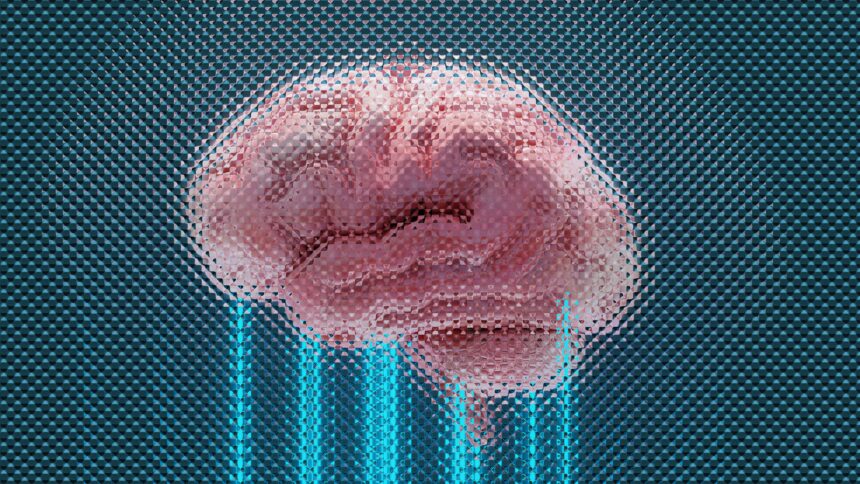
Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden, brauchen Hilfe. Doch auf dem Weg zu angemessener Unterstützung gibt es viele Hürden: Hilfesuchende müssen teils mehrere Monate warten, bis sie einen ambulanten Psychotherapieplatz bekommen, in ländlichen Gebieten bis zu einem Jahr. Noch immer hält die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen viele davon ab, sich überhaupt in Behandlung zu begeben.
Diese Angst vor Stigmatisierung wird nun weiter genährt durch die Innenminister:innen von Bund und Ländern, die auf ihrer Konferenz im Juni psychische Erkrankungen vor allem als sicherheitsbehördliches Thema und nicht als Problem der Gesundheitsversorgung dargestellt haben.
Datenaustausch mit der Polizei zu psychischen Erkrankungen
In einem der Beschlüsse der Innenministerkonferenz fordern die Minister:innen ein „integriertes Risikomanagement“ bei Menschen mit psychischen Erkrankungen. Es geht dabei um das Risiko, dass psychisch erkrankte Personen Straf- und insbesondere Gewalttaten begehen könnten. Um dem zu begegnen, wollen die Innenminister:innen mehr Datenaustausch, an dem sich Gesundheits-, Sicherheits-, Justiz- und Ausländerbehörden beteiligen sollen.
„Bei einem identifizierten Gefährdungspotenzial muss ein gemeinsames integriertes Fallmanagement einsetzen, mit dem Ziel, alle gesundheitsbehördlichen und polizeilichen sowie ggf. aufenthaltsrechtlichen Möglichkeiten zum Schutz anderer Menschen vor diesem Risiko auszuschöpfen“, heißt es im Beschluss.
Ähnlich klingt eine Entschließung der Gesundheitsminister:innen von Bund und Ländern, die ebenfalls im Juni tagten. Sie wollen denn „Austausch von Gesundheitsdaten und den Erkenntnissen der Gefahrenabwehrbehörden unter datenschutzrechtlichen Vorgaben“ prüfen.
Stigmatisierung statt Hilfe
Beide Beschlüsse stehen unter dem Eindruck mehrerer bundesweit diskutierter Gewalttaten der vergangenen Monate. Im Mai griff eine Frau am Hamburger Hauptbahnhof Menschen mit einem Messer an, sie war erst einen Tag zuvor aus einer psychiatrischen Klinik entlassen worden. Im vergangenen Dezember fuhr ein Mann mit einem Auto in den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Bei der Amokfahrt tötete und verletzte er mehrere Menschen. Zuvor war er wiederholt wegen wahnhafter Äußerungen aufgefallen und bereits wegen der Androhung von Straftaten verurteilt worden.
Nach der Tat im Dezember hatte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ein Register für psychisch erkrankte Gewalttäter gefordert. Mehrere Psychiater:innen und Psychotherapeut:innen hatten damals die Forderungen vehement abgelehnt. Sie forderten eine bessere und niedrigschwelligere Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen statt weiterer Stigmatisierung. Außerdem wiesen sie darauf hin, dass nur selten ein direkter Zusammenhang zwischen einer psychischen Erkrankung und einer Gewalttat bestünde.
Dieser Einwand wird durch wissenschaftliche Untersuchungen gestützt. In einer Übersichtsarbeit schrieb die kanadische Sozialepidemiologin Heather Stuart, die zur Stigmatisierung psychischer Erkrankungen forscht: „Psychische Störungen sind weder notwendige noch hinreichende Ursachen für Gewalt.“ Viel relevanter für das Risiko, eine Gewalttat zu begehen, seien soziodemografische und sozioökonomische Faktoren wie Jugend, Männlichkeit und ein niedriger sozioökonomischer Status.“ Der Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen und Gewalttaten sei in der öffentlichen Wahrnehmung überschätzt.
„Prävention gelingt durch Hilfe, nicht durch Verdacht“
Das kritisiert auch Elisabeth Dallüge. Sie ist Mitglied des Bundesvorstandes der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung. Der Berufsverband sehe den Beschluss der Innenministerkonferenz „mit großer Sorge“, schreibt sie gegenüber netzpolitik.org: „Auch wenn er sich formal auf eine kleine Risikogruppe bezieht, verfestigt er strukturell den Eindruck, psychische Erkrankungen seien ein isoliertes Sicherheitsrisiko – das befördert Stigmatisierung und behindert Versorgung.“ Der geplante Austausch von Gesundheitsdaten zwischen verschiedenen Behörden stelle die Schweigepflicht infrage und gefährde „das Vertrauensverhältnis, das für jede Behandlung essenziell ist.“
Nach Meinung der PsychotherapeutenVereinigung brauche es keine Kontrolle, sondern eine „konsequent ausfinanzierte, multiprofessionelle Versorgung – mit spezialisierten Ambulanzen, klarer Verantwortung im Gesundheitswesen und einer gesetzlichen Einbindung psychotherapeutischer Expertise“.
Andere Vorschläge der Innenministerkonferenz gingen in eine richtige Richtung, etwa ein Reformvorschlag zu den Psychisch-Kranken-Gesetzen der Länder. Dort soll geprüft werden, wie unterhalb der Schwelle einer Zwangsunterbringungen etwa verpflichtende Therapieauflagen oder eine überprüfte Medikamenteneinnahme umgesetzt werden könnten. Das könne sinnvoll sein, schreibt Dallüge – „vorausgesetzt, die Maßnahmen erfolgen im Rahmen eines gestuften, therapeutisch begleiteten Nachsorgekonzepts.“
Die Psychotherapeutin Dallüge, die selbst Erfahrungen in der Arbeit im Maßregelvollzug hat, fasst zusammen: „Prävention gelingt durch Hilfe, nicht durch Verdacht.“
Gewaltrisiko kann durch Angst vor Stigmatisierung steigen
Die Fachgesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (DGPPN) hat ein Positionspapier verfasst, das zu ähnlichen Ergebnissen kommt. Die Präsidentin der Gesellschaft, Prof. Dr. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank, sagt dazu: „Wir brauchen keine neuen gesetzlichen Regelungen oder Konstrukte – wir müssen die bestehenden Möglichkeiten besser anwenden. Register oder die Weitergabe von medizinischen Daten an Behörden mindern das Gewaltrisiko nicht.“ Stattdessen könne das Risiko für Gewalttaten steigen, „wenn die Furcht vor Stigmatisierung dazu führt, dass Betroffene nicht zum Arzt gehen oder sich erst spät behandeln lassen“, so die Neurologin und Psychiaterin.
Welche Daten genau ausgetauscht werden sollen, wie ein Risikopotenzial ermittelt werden kann und welche Gesetze in Bund und Ländern dafür geändert werden müssen, konkretisieren weder Gesundheits- noch Innenminister:innen. Müssen Menschen, die sich etwa wegen Wahnideen ärztliche Hilfe suchen, nun Angst haben, dass Informationen zu ihren Symptomen bei der Polizei landen? Der Arbeitskreis „Früherkennung und Bedrohungsmanagement“ soll bis zur Herbstsitzung der Innenminister:innen die Vorschläge zu Datenaustausch und Risikoerkennung weiter ausarbeiten.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.