Das Jahr Null der elektronischen Patientenakte war mit zahlreichen Problemen gepflastert. Gelöst sind diese noch lange nicht, warnt die Sicherheitsforscherin Bianca Kastl. Auch deshalb drohten nun ganz ähnliche Probleme auch bei einem weiteren staatlichen Digitalisierungsprojekt.

Rückblickend sei es ein Jahr zahlreicher falscher Risikoabwägungen bei der IT-Sicherheit im Gesundheitswesen gewesen, lautete das Fazit von Bianca Kastl auf dem 39. Chaos Communication Congress in Hamburg. Und auch auf das kommende Jahr blickt sie wenig optimistisch.
Kastl hatte gemeinsam mit dem Sicherheitsexperten Martin Tschirsich auf dem Chaos Communication Congress im vergangenen Jahr gravierende Sicherheitslücken bei der elektronischen Patientenakte aufgezeigt. Sie ist Vorsitzende des Innovationsverbunds Öffentliche Gesundheit e. V. und Kolumnistin bei netzpolitik.org.
Die Sicherheitslücken betrafen die Ausgabeprozesse von Versichertenkarten, die Beantragungsportale für Praxisausweise und den Umgang mit den Karten im Alltag. Angreifende hätten auf jede beliebige ePA zugreifen können, so das Fazit der beiden Sicherheitsexpert:innen im Dezember 2024.
„Warum ist das alles bei der ePA so schief gelaufen?“, lautet die Frage, die Kastl noch immer beschäftigt. Zu Beginn ihres heutigen Vortrags zog sie ein Resümee. „Ein Großteil der Probleme der Gesundheitsdigitalisierung der vergangenen Jahrzehnte sind Identifikations- und Authentifizierungsprobleme.“ Und diese Probleme bestünden nicht nur bei der ePA in Teilen fort, warnt Kastl, sondern gefährdeten auch das nächste große Digitalisierungsvorhaben der Bundesregierung: die staatliche EUDI-Wallet, mit der sich Bürger:innen online und offline ausweisen können sollen.
Eine Kaskade an Problemen
Um die Probleme bei der ePA zu veranschaulichen, verwies Kastl auf eine Schwachstelle, die sie und Tschirsich vor einem Jahr aufgezeigt hatten. Sie betrifft einen Dienst, der sowohl für die ePA als auch für das E-Rezept genutzt wird: das Versichertenstammdaten-Management (VSDM). Hier sind persönliche Daten der Versicherten und Angaben zu deren Versicherungsschutz hinterlegt. Die Schwachstelle ermöglichte es Angreifenden, falsche Nachweise vom VSDM-Server zu beziehen, die vermeintlich belegen, dass eine bestimmte elektronische Gesundheitskarte vor Ort vorliegt. Auf diese Weise ließen sich dann theoretisch unbefugt sensible Gesundheitsdaten aus elektronischen Patientenakten abrufen.
Nach den Enthüllungen versprach der damalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einen ePA-Start „ohne Restrisiko“. Doch unmittelbar nach dem Starttermin konnten Kastl und Tschirsich in Zusammenarbeit mit dem IT-Sicherheitsforscher Christoph Saatjohann erneut unbefugt Zugriff auf die ePA erlangen. Und auch dieses Mal benötigten sie dafür keine Gesundheitskarte, sondern nutzten Schwachstellen im Identifikations- und Authentifizierungsprozess aus.
„Mit viel Gaffa Tape“ sei die Gematik daraufhin einige Probleme angegangen, so Kastl. Wirklich behoben seien diese jedoch nicht. Für die anhaltenden Sicherheitsprobleme gibt es aus ihrer Sicht mehrere Gründe.
So hatte Lauterbach in den vergangenen Jahren zulasten der Sicherheit deutlich aufs Tempo gedrückt. Darüber hinaus verabschiedete der Bundestag Ende 2023 das Digital-Gesetz und schränkte damit die Aufsichtsbefugnisse und Vetorechte der Bundesdatenschutzbeauftragten (BfDI) und des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) massiv ein. „Ich darf jetzt zwar etwas sagen, aber man muss mir theoretisch nicht mehr zuhören“, fasste die Bundesdatenschutzbeauftragte Louisa Specht-Riemenschneider die Machtbeschneidung ihrer Aufsichtsbehörde zusammen.
EUDI-Wallet: Fehler, die sich wiederholen
Auch deshalb sind aus Kastls Sicht kaum Vorkehrungen getroffen worden, damit sich ähnliche Fehler in Zukunft nicht wiederholen. Neue Sicherheitsprobleme drohen aus Kastls Sicht schon im kommenden Jahr bei der geplanten staatlichen EUDI-Wallet. „Die Genese der deutschen staatlichen EUDI-Wallet befindet sich auf einem ähnlich unguten Weg wie die ePA“, warnte Kastl.
Die digitale Brieftasche auf dem Smartphone soll das alte Portemonnaie ablösen und damit auch zahlreiche Plastikkarten wie den Personalausweis, den Führerschein oder die Gesundheitskarte. Die deutsche Wallet soll am 2. Januar 2027 bundesweit an den Start gehen, wie Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) vor wenigen Wochen verkündete.
Kastl sieht bei dem Projekt deutliche Parallelen zum ePA-Start. Bei beiden ginge es um ein komplexes „Ökosystem“, bei dem ein Scheitern weitreichende Folgen hat. Dennoch seien die Sicherheitsvorgaben unklar, außerdem gebe es keine Transparenz bei der Planung und der Kommunikation. Darüber hinaus gehe die Bundesregierung bei der Wallet erneut Kompromisse zulasten der Sicherheit, des Datenschutzes und damit der Nutzer:innen ein.
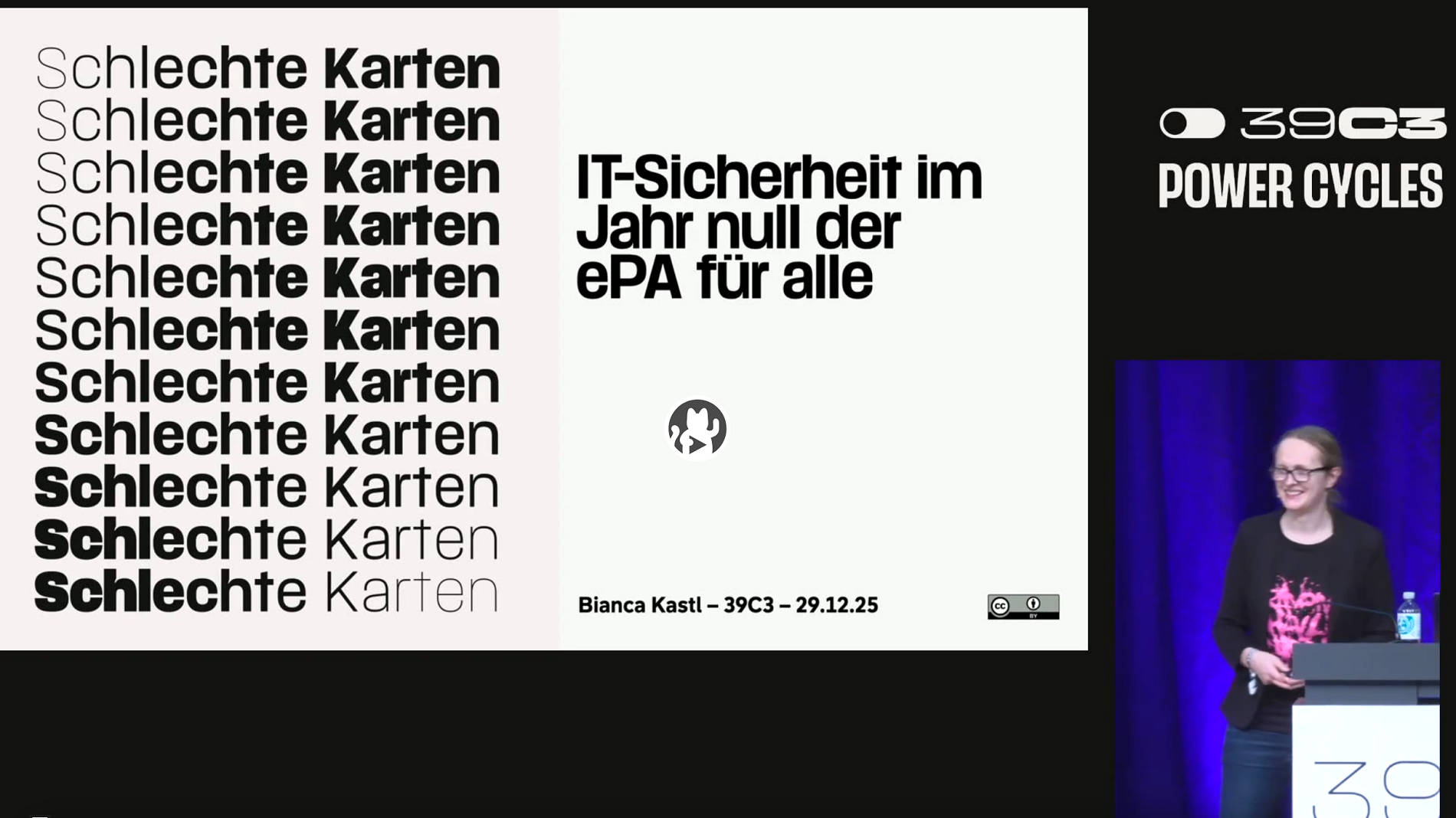
Signierte Daten, bitte schnell
In ihrem Vortrag verweist Kastl auf eine Entscheidung der Ampel-Regierung im Oktober 2024. Der damalige Bundes-CIO Markus Richter (CDU) verkündete auf LinkedIn, dass sich das Bundesinnenministerium „in Abstimmung mit BSI und BfDI“ für eine Architektur-Variante bei der deutschen Wallet entschieden habe, die auf signierte Daten setzt. Richter ist heute Staatssekretär im Bundesdigitalministerium.
Der Entscheidung ging im September 2024 ein Gastbeitrag von Rafael Laguna de la Vera in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung voraus, in dem dieser eine höhere Geschwindigkeit bei der Wallet-Entwicklung forderte: „Nötig ist eine digitale Wallet auf allen Smartphones für alle – und dies bitte schnell.“
Laguna de la Vera wurde 2019 zum Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) berufen, die derzeit einen Prototypen für die deutsche Wallet entwickelt. Seine Mission hatte der Unternehmer zu Beginn seiner Amtszeit so zusammengefasst: „Wir müssen Vollgas geben und innovieren, dass es nur so knallt.“ In seinem FAZ-Text plädiert er dafür, die „‚German Angst‘ vor hoheitlichen Signaturen“ zu überwinden. „Vermeintlich kleine Architekturentscheidungen haben oft große Auswirkungen“, schließt Laguna de la Vera seinen Text.
Sichere Kanäle versus signierte Daten
Tatsächlich hat die Entscheidung für signierte Daten weitreichende Folgen. Und sie betreffen auch dieses Mal die Identifikations- und Authentifizierungsprozesse.
Grundsätzlich sind bei der digitalen Brieftasche zwei unterschiedliche Wege möglich, um die Echtheit und die Integrität von übermittelten Identitätsdaten zu bestätigen: mit Hilfe sicherer Kanäle („Authenticated Channel“) oder durch das Signieren von Daten („Signed Credentials“).
Der sichere Kanal kommt beim elektronischen Personalausweis zum Einsatz. Hier wird die Echtheit der übermittelten Personenidentifizierungsdaten durch eine sichere und vertrauenswürdige Übermittlung gewährleistet. Die technischen Voraussetzungen dafür schafft der im Personalausweis verbaute Chip.
Bei den Signed Credentials hingegen werden die übermittelten Daten etwa mit einem Sicherheitsschlüssel versehen. Sie tragen damit auch lange nach der Übermittlung quasi ein Echtheitssiegel.
Kritik von vielen Seiten
Dieses Siegel macht die Daten allerdings auch überaus wertvoll für Datenhandel und Identitätsdiebstahl, so die Warnung der Bundesdatenschutzbeauftragten, mehrerer Sicherheitsforscher:innen und zivilgesellschaftlicher Organisationen.
Bereits im Juni 2022 wies das BSI auf die Gefahr hin, „dass jede Person, die in den Besitz der Identitätsdaten mit Signatur gelangt, über nachweislich authentische Daten verfügt und dies auch beliebig an Dritte weitergeben kann, ohne dass der Inhaber der Identitätsdaten dies kontrollieren kann“.
Und der Verbraucherschutz Bundesverband sprach sich im November 2024 in einem Gutachten ebenfalls klar gegen signierte Daten aus.
Risiken werden individualisiert
An dieser Stelle schließt sich für Kastl der Kreis zwischen den Erfahrungen mit der elektronischen Patientenakte in diesem Jahr und der geplanten digitalen Brieftasche.
Um die Risiken bei der staatlichen Wallet zu minimieren, sind aus Kastls Sicht drei Voraussetzungen entscheidend, die sie und Martin Tschirsich schon auf dem Congress im vergangen Jahr genannt hatten.
Das sind erstens eine unabhängige und belastbare Bewertung von Sicherheitsrisiken, zweitens eine transparente Kommunikation von Risiken gegenüber Betroffenen und drittens ein offener Entwicklungsprozess über den gesamten Lebenszyklus eines Projekts. Vor einem Jahr fanden sie bei den Verantwortlichen damit kein Gehör.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.




